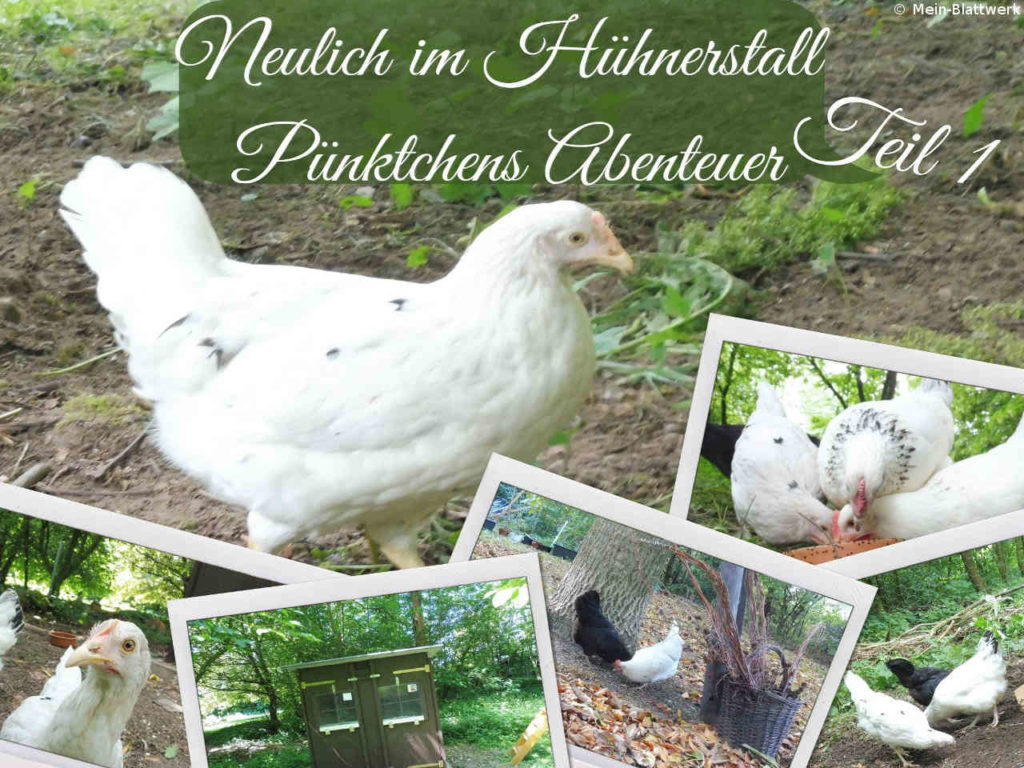Fahren wir also mit der Geschichte fort, solange ich sie noch erzählen kann. Du hast ja sicher im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich auch das ein oder andere nicht mehr so ganz genau weiß. Das liegt daran, dass das alles schon so lange her ist und ich viele Jahre nicht daran gedacht habe. Tatsächlich habe ich noch vorher noch nie jemandem von dem Tag erzählt, an dem ich damals Sheriff war. Und nur dadurch, dass ich dir nun davon erzähle, sind viele meiner Erinnerungen plötzlich wieder wach geworden. Ohne das Erzählen wäre das vielleicht nie mehr geschehen. Um alte Geschichten vor dem Vergessenwerden zu bewahren, scheint mir das Erzählen doch eine wichtige Sache zu sein. Vergiss also nicht, auch deine Geschichten jemandem zu erzählen.
Nun soll es aber auch endlich losgehen, bevor mir wieder ganz andere Geschichten einfallen. Ich hatte mich ja gerade auf den Weg zur Straße gemacht, um mit meiner neuen Sheriffaufgabe „Freund und Helfer“ zu beginnen. Ich rannte also aus dem Garten nach vorn zur Bundestraße. Dort stand das grüne Ortsschild, auf dem in gelben Buchstaben „Ammerswurth“ stand. Das wusste ich genau, obwohl ich, wie du ja auch genau weißt, damals noch nicht lesen konnte.
Direkt an dem grünen Schild wollte ich erst einmal auf Menschen warten, die meine Hilfe benötigen würden. Mir schien das doch ein geeigneter Platz zu sein. So würde der Ammerswurther Dorfsheriff direkt am Ammerswurther Ortsschild zu finden sein. Jeder, der von Meldorf oder von Elpersbüttel aus durch Ammerswurth kommen würde, konnte mich dort gut sehen. Ich setzte mich also unter das Schild und stellte die blaue Tasche mit meiner Sheriffausrüstung neben mir ins Gras. Natürlich achtete ich darauf, dass mein Sheriffstern an meiner Sheriffhose gut zu sehen war und nicht etwa das T-Shirt ihn verdeckte. Ohne den silbernen Stern würde ja niemand erkennen, dass ich der Sheriff war. Schließlich war es doch mein erster Arbeitstag und die Menschen mussten mich ja erst noch kennenlernen.
Ich behielt die Bundesstraße genau im Blick und wartete darauf, dass der erste Autofahrer anhalten würde, um mich um meine Hilfe zu bitten. Radfahrer oder Fußgänger waren nämlich weit und breit nicht in Sicht. Dabei versuchte ich zu erraten, welchen Gegenstand von meiner Sheriffausrüstung ich wohl als erstes brauchen würde. Das Taschentuch vielleicht? Ja, das war gut möglich. Das Eukalyptusbonbon würde es wohl eher nicht sein, wenn mein erster Fall ein Autofahrer war. Alle Autos hatten ja schließlich ihre eigenen Handschuhfächer und in den meisten davon klebten sicher auch braune, scharfe oder irgendwelche anderen Bonbons. Da brauchten die Autofahrer meins nicht auch noch.
Irgendwann war ich in Gedanken alle Sachen aus meiner Tasche durchgegangen und hatte sie nach danach sortiert, wie nützlich sie für Autofahrer sein konnten. An die genaue Reihenfolge kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Mein Bilderbuch war aber auf jeden Fall sehr nützlich, falls sich ein Kind hinten auf dem Rücksitz langweilte. Genauso das Geduldsspiel mit der Katze darauf. Nadel und Faden kamen auf einen der hinteren Plätze. Beim Autofahren verliert man ja wohl eher selten einen Knopf und während der Fahrt kannst du auch nicht gut nähen. Das ganze Überlegen dauerte schon eine Weile und es hatte noch kein einziges Auto angehalten. Kein Autofahrer kam auf die Idee, mich nach irgendetwas zu fragen, nicht einmal nach dem richtigen Weg nach Meldorf, nach Elpersbüttel oder zum Deich. Alle fuhren einfach vorbei.
Auf dem Radfahrweg war auch niemand zu sehen. Wahrscheinlich machten die Radfahrer und Fußgänger alle gerade Mittagstunde wie meine Eltern. Wirklich eine langweilige Erfindung, diese Mittagstunde! Wer will schon bei so schönem Wetter drinnen im Bett liegen, obwohl er gar nicht krank ist? Ich zumindest nicht! Aber Langeweile bekam ich jetzt so langsam auch ein bisschen bei diesem Herumsitzen und Warten. Ich holte also mein kleines Buch heraus und guckte mir zweimal von vorne bis hinten an, wie Petzi einen Wal hütet. Danach kramte ich das Geduldsspiel heraus. Ich schaffte es dreimal, die beiden Kugeln in die Augen der Katze zu bekommen. Dann hatte ich keine Lust mehr dazu.
Hätte ich doch bloß ein paar mehr Bücher und Spielsachen mitgenommen, zum dumm! Ich nahm die große Nadel und das Garn aus der blauen Tasche und versuchte, das Ende des Fadens durch das Nadelöhr zu schieben. Das war ja auch so eine Art Geduldsspiel. Als ich gerade zum drittenmal das Garn angeleckt hatte, damit es sich besser einfädeln ließ, sah ich plötzlich aus Richtung Elpersbüttel ein Fahrrad herankommen. Na endlich! Ich ließ sofort Nadel und Faden in den Schoß fallen und setzte mich kerzengerade hin. Der Radfahrer war ein Mann in einem blauen Arbeitsanzug. Ich blickte ihm ermutigend entgegen. „Ich kann dir bestimmt weiterhelfen!“, dachte ich bei mir.
Als er näherkam, bemerkte er mich schließlich auch. Auf Höhe des Schildes angekommen, nickte er einmal und sagte: „Moin!“. Das war alles. Er fuhr einfach weiter, ob du es glaubst oder nicht. Was für eine Riesenenttäuschung! Mein kerzengerader Rücken sackte zusammen, als ich dem Mann nachblickte. Ich ließ die Hand, die ich schon an meiner Sherifftasche gehabt hatte, in den Schoß sinken und piekte mich dabei an der großen Nadel, die da ja auch noch lag. Aber nur ein bisschen, denn besonders spitz war sie zum Glück nicht. Dieses Sheriffsein war doch wirklich unfassbar schwierig! Dabei sah es in den alten Western im Fernsehen immer so einfach aus.
Etwas niedergeschlagen und ganz in Gedanken holte ich das Eukalyptusbonbon aus der Tasche und wickelte es vorsichtig aus. Es war ganz mit dem Bonbonpapier verklebt, so dass ich es mit den Zähnen abziehen musste. Aber es schmeckte schön scharf und irgendwie auch ein bisschen tröstlich. Während ich lutschte, versuchte ich mir einen neuen Plan auszudenken. Ich konnte ja schließlich nicht den ganzen Nachmittag langweilig und untätig hier im Gras unter dem Schild sitzenbleiben. Noch bevor ich das Bonbon aufgegessen hatte, war mir tatsächlich auch etwas eingefallen, das ich noch versuchen konnte, um meine Sheriffehre zu retten.
Und zwar war mir eingefallen, dass meine Mutter eines Abends draußen mal einen Jungen gefunden hatte, der sich verlaufen hatte. Die Geschichte war ein bisschen merkwürdig oder zumindest habe ich sie nicht ganz verstanden. Es war nämlich so, dass der Junge von zu Hause weglaufen wollte und sich dann im Dunkeln verlaufen hat. Die Frage, die sich mir damals gestellt hatte, war, wie du dich denn verlaufen kannst, wenn doch nur weglaufen willst. Er wollte zu gar keinem bestimmten Ort hin und dann kannst du ja eigentlich auch gar keinen falschen Weg nehmen. Aber so war es nun mal. Jedenfalls weinte er ganz schrecklich und meine Mutter brachte den Jungen ins Wohnzimmer, von wo aus er seine Mutter anrief. Dort weinte er weiter, bis sie schließlich kam und ihn abholte.
Das mit dem Weinen konnte ich schon verstehen. Als ich einmal von zu Hause weglaufen wollte, habe ich schon geweint, als ich noch in meinem Kinderzimmer war. Ein bisschen geweint habe ich, weil ich wütend auf meine Eltern war. Warum ich das war, weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall wütend, sonst hätte ich ja nicht weglaufen wollen. Noch wütender wurde ich aber, als ich versuchte meine Sachen zu packen. Ich hatte mein Bett schon abgezogen und wollte das Bettlaken als erstes in meine Tasche stecken. Ich schaffte es auch, aber nur mit richtig feste drücken und quetschen und dann war die Tasche voll. Ich konnte doch nicht nur mit einem Bettlaken draußen schlafen. Und was war mit all meinen anderen wichtigen Sachen? Ich glaube, ich war noch wütender auf die zu kleine Tasche als auf meine Eltern. Und da habe ich dann richtig geweint und den Plan aufgegeben. Das Bett hat dann später meine Mutter für mich neu bezogen. Aber weglaufen wollen und weinen gehören wohl irgendwie zusammen. Jedenfalls war es bei den beiden Malen so, die ich miterlebt habe, bei dem Jungen und bei mir selbst.
Dass mir die Geschichte von dem Jungen wieder eingefallen war, war an dem Tag, an dem ich Sheriff war, aber nicht zum Weinen sondern ein richtiger Glücksfall. Es war doch eine gute Aufgabe, nach Menschen suchen, die sich verlaufen hatten und ihnen zu helfen, wieder nach Hause zu finden! Ein sehr guter Plan! Ich sprang sofort auf und schnappte mir meine Sherifftasche, um augenblicklich mit der Suche zu beginnen und ich wusste auch schon wo.
Ein guter Platz, um dich zu verlaufen ist ein großes, hohes Weizenfeld, wie das in Ammerswurth hinter dem Graben mit meinem Kletterbaum. Wenn du noch nicht so groß bist, ist das Getreide fast so hoch wie du selbst, so dass du wirklich nicht weit gucken kannst. In so einem Meer aus hohen Ähren, die alle fast gleich aussehen, verirrst du dich ganz leicht. Aber falls sich in unserem Weizenfeld gerade jemand verirrt hatte, musste er keine Angst haben und brauchte auch nicht zu weinen, denn der Sheriff war ja bereits dahin unterwegs, um ihm sofort zu helfen.
Im Laufen fiel mir ein, dass ich ohne es zu ahnen, zwei Gegenstände eingepackt hatte, die genau für die Aufgabe, einen Verirrten zu finden, wirklich unglaublich nützlich waren. Die Trillerpfeife und das Taschentuch! Mit der Trillerpfeife konnte ich gut auf mich aufmerksam machen. Dann wüsste der Verirrte, dass Hilfe unterwegs war und konnte schon mal in die Richtung laufen, aus der das Pfeifen kam. Dann würde ich das große, blaue Taschentuch mit ausgetrecktem Arm über meinem Kopf schwenken, damit er mich in dem hohen Getreide ausmachen könnte.
Am Feld angekommen, holte ich also Pfeife und Taschentuch aus der Tasche. Ich steckte die Trillerpfeife zwischen meine Lippen, zog sie aber sofort wieder heraus. Ach Mensch, ich hatte ja noch den Rest des Eukalyptusbonbons im Mund! Nun klebte die ganze Pfeife und das kleine Loch zum Hineinpusten war verstopft. So was Dummes! Ich zerkaute das Bonbon so schnell ich konnte und schluckte die letzten Krümel so schnell wie möglich herunter. Anschließend lutschte ich dann so lange an der Pfeife, bis sie nicht mehr klebte und das Loch wieder frei war. Ein kurzer Probepfiff. Ja, geschafft, die Trillerpfeife funktionierte tadellos.
Ich wanderte pfeifend in das Weizenfeld hinein und schwenkte dabei das Taschentuch so hoch über meinem Kopf wie ich nur konnte. Wer auch immer sich hier verlaufen hatte, musste mich von Weiten hören und mit ein bisschen Glück auch sehen. Ich hielt mich etwas am Rand des Feldes, von wo aus ich den Graben gerade noch sehen konnte. Es wäre ja ziemlich unpraktisch gewesen, hätte ich mich ausgerechnet auf der Suche nach verirrten Menschen noch selbst im Weizen verlaufen. Lieber auf Nummer Sicher gehen, dachte ich mir.
Die trockenen Weizenhalme raschelten, als ich mir meinen Weg durch das Feld bahnte. Die Ähren waren schon ganz groß und gelb. Wahrscheinlich würde bald Erntezeit sein. Oh, das waren immer tolle Tage Dann kamen Herr Huesmann und seine Leute mit ihren großen Mähdreschern. Das waren die größten Fahrzeuge, die ich kannte. Sie mähten und droschen von früh bis spät und ganz Ammerswurth duftete nach frischem Stroh und dem Korn, das in großen Hängern gesammelt und abtransportiert wurde.
Die Mähdrescherfahrer durften immer nur ganz kurze Pausen machen. Deshalb musstest du ihnen zum Frühstück, zum Mittag und zum Kaffee etwas zu essen direkt ans Feld bringen. Meine Mutter packte für jeden von ihnen ein paar Mal am Tag ein ganzes Körbchen voll leckerer Dinge. Doppelschnitten mit dem Brot von Bäcker Timm waren auch ganz oft dabei und Kuchen und eine Kanne Kaffee. Gut, den mochte ich selbst natürlich nicht, aber die Mähdrescherfahrer fanden mit Sicherheit alles köstlich, was meine Mutter ihnen einpackte, denn sie ließen nie auch nur einen Krümel von irgendetwas übrig.
Manchmal durfte ich so ein Körbchen zu einem der Mähdrescherfahrer bringen, entweder zu Fuß oder mit meinem kleinen grünen Rad, wenn das Feld ein bisschen weiter weg war. Am Feld angekommen, musstest du das Körbchen dann abstellen und ganz doll winken, damit der Mann am Steuer dich bemerkte und wusste, dass es endlich Essen gab und wo du es ihm hingestellt hattest. Nein, rufen hätte nichts genützt. So ein Mähdrescher ist wirklich laut, glaub mir. Und er macht auch jede Menge Staub, in seiner Nähe lässt du den Mund besser zu. Jedenfalls, Körbchen ausliefern tat ich gerne und freute mich schon darauf, als ich so durch den reifen Weizen marschierte.
Eine Sache gab es allerdings an der Erntezeit, auf die ich mich noch mehr freute und das waren die Abende. Wenn nämlich richtig gutes Wetter war, mähten die Mähdrescher bis spät in den Abend, manchmal in die Nacht. Dann machten sie vorne große Lampen an, um erkennen zu können, wo noch Getreide abzumähen war. Wenn sich so ein großer Mähdrescher mit einer hellen Lampe im Dunkeln durch ein Weizenfeld frisst, sieht das schon sehr beeindruckend aus. Aber manchmal machte Herr Huesmann es noch sogar beeindruckender.
Dann schickte er spät am Abend alle seine Mähdrescher zusammen auf das letzte Feld, das noch nicht fertig abgedroschen war. Das hättest du sehen sollen! Dicht nebeneinander zogen die riesigen Maschinen mit ihren großen Lampen ihre Bahnen und ließen das ganze Feld goldgelb leuchten, als läge es in hellem Sonnenschein, obwohl es rundherum stockdunkel war. Das Tollste kam aber zum Schluss. Wenn alle Ähren abgeerntet waren und auf dem Feld nur das liegengebliebene Stroh und die Stoppeln übrig waren, machten sich alle Mähdrescher auf den Weg zu unserem Hof. In einer Schlange hintereinander fuhren sie die Straße entlang. Vor Freude, dass die Ernte geschafft war, entzündeten sie orangeleuchtende Blinklichter auf ihren Dächern. Das sah aus wie ein Freudenfeuerwerk auf der Straße vor unserem Haus.
Ich stand dann am Fenster und freute mich über das Schauspiel in der Ammerswurther Nacht und natürlich darüber, dass ich ausnahmsweise so lange aufbleiben durfte. Erntetage waren immer für alle so aufregend, dass niemand daran dachte, mich ins Bett zu schicken. Mein Vater, so glaube ich zumindest, freute sich auch immer über die blinkende Mähdrescherkolonne. Während er die Stunden vor dem Blinklichtfeuerwerk immer besorgt ausgesehen hatte und den Himmel nach Regenwolken abgesucht oder nach einem fernen Donnergrollen gehorcht hatte, sah er auch immer ganz glücklich und erleichtert aus, wenn Herr Huesmanns Mähdrescher blinkend und tösend auf den Hof gefahren kamen.
Meine Mutter konnte das leider nie mit uns zusammen genießen. An diesen besonders tollen Tagen musste sie nämlich bis in die Nacht in der Küche stehen. Die ganzen Mähdrescherfahrer waren immer schon wieder ganz hungrig, wenn sie schließlich mit dem Dreschen fertig waren, trotz der ganzen Körbchen, die wir ihnen über den Tag gebracht hatten. Mähdrescherfahren muss wirklich sehr anstrengend sein, mindestens so anstrengend wie Sheriffsein, denke ich. Deshalb machte meine Mutter immer große Pfannen voller Bratkartoffeln und Spiegeleier. Da du ja nie genau wusstest, wann sie denn kommen würden, musste sie das Essen den ganzen Abend lang warm halten und aufpassen, dass nichts anbrannte. Aber irgendwann war es dann endlich soweit und all die hungrigen und staubigen Mähdrescherfahrer saßen in unserer Küche um die Bratpfannen herum, bis alles aufgegessen war. Dann fuhren sie mit ihren großen Mähdreschern blinkend durch die Nacht nach Hause. Was sie wohl bis zur Ernte im nächsten Jahr machten? Vielleicht hatten sie immer sehr lange Ferien.
Darüber und über vieles mehr dachte ich nach, während ich weiter mit dem Taschentuch winkte und auf meiner Pfeife pfiff. Ab und zu hielt ich inne und horchte angestrengt, ob von irgendwoher aus der Mitte des Feldes Hilferufe zu hören waren. Nichts! Alles, was ich hörte war das Blöken der Schafe im Apfelgarten und an und zu eine Kuh, die in der Ferne muhte. Inzwischen hatte ich schon das halbe Feld umrundet und es hatte sich noch kein einziger Verirrter gezeigt. Trotzdem setzte ich meinen Weg pfeifend und winkend fort, bis ich wieder an der Feldeinfahrt gegenüber von unserem Hof angekommen war. Einmal ganz um das Feld herum war ich gelaufen.
Das war ein ziemlich weiter Weg gewesen, denn das Feld war wirklich groß und durch ein Kornfeld zu laufen ist auch viel anstrengender als zum Beispiel einen Weg entlangzugehen oder auf frisch gemähtem Rasen zu rennen. Ich war ganz schön erledigt und vom vielen Pfeifen und Winken auch etwas außer Atem. Natürlich war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass ich wieder niemanden gefunden hatte, dem ich helfen konnte, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich doch hauptsächlich ziemlich erschöpft war.
Also beschloss ich, mir nun einen Platz zu suchen, an dem ich mich ungestört ein bisschen ausruhen und die Lage trotzdem im Blick behalten konnte. Klar, mein Baumhaus wäre auch ein guter Ort dafür gewesen, da hast du Recht, aber in dem Moment hatte ich ein anderes Plätzchen im Sinn. Vor dem Hof von unserem Nachbarn Onkel Otto, der natürlich auch wieder nur so hieß, aber gar nicht mein Onkel war, gab es eine ganz dichte Weißdornhecke. Sie lief parallel zu der Teerstraße mit den pieksigen Steinen. Das Tolle an der Hecke war, dass es hinter ihr einen Geheimgang gab. Du konntest durch ein kleines Loch hinter die Hecke gelangen und dann ein ganzes Stück direkt neben der Straße weitergehen, ohne dass dich jemand sah. Am anderen Ende der Hecke gab es noch eine Öffnung, durch die du wieder auf den Weg zurückkamst.
Das war doch der perfekte Ort für eine kleine Pause. Ich konnte mich dort ein bisschen hinsetzen und durch das Loch auf die Straße spähen. So könnte ich schnell eingreifen, falls doch noch jemand den Sheriff brauchen würde, aber niemand würde bemerken, dass ichwährend der Arbeit gerade so was wie eine Mittagstunde machte. Ich lief also schnell über unseren Hof und durch den Obstgarten der Nachbarn bis zu der Weißdornhecke. Dort setzte ich mich im Schneidersitz auf den Boden. Gras wuchs dort zwar nicht, sondern es gab nur blanke Erde, dafür war es aber schön schattig und kühl. Das war doch recht angenehm, nach der anstrengenden Feldumrundung in der prallen Nachmittagssonne. Auf der Straße war niemand zu sehen. Also nahm ich nochmal „Petzi hütet einen Wal“ aus meiner Tasche und begann darin zu blättern. Das war ein bisschen langweilig, schließlich hatte ich mir die Geschichte an diesem Tag ja schon drei Mal angeguckt. Also packte ich es wieder ein und saß einfach nur so da, während ich ausruhte und auf Menschen wartete, die einen Freund und Helfer benötigten. Darüber muss ich wohl ganz kurz eingenickt sein.
Auf einmal schreckte ich auf. Ein lautes metallisches Klappern und Rasseln näherte sich. Das Geräusch an sich war es aber nicht, was mich erschreckte, denn es war mir wohl vertraut. Nein, ich erschrak, weil mir dieses Geklapper und Gerassel sagte: Sünje, du hast mal wieder komplett die Zeit vergessen und bist zu spät zum Abendessen dran. „Hoffentlich gibt das keinen Ärger.“, dachte ich etwas beunruhigt. Schon nach sechs, au backe.
Woher ich das wusste, fragst du? Na, ganz klar. Jeden Abend um sechs wurde alle Ammerswurther Kühe gemolken. Jeder Bauer füllte seine Milch in große silberne Metallkannen und brachte sie mit einem Handkarren an die Teerstraße, die rund um Ammerswurth führte. Dieses Klappern, das ich gehört hatte, war die Karre von Onkel Otto mit seinen Kannen. Also war er mit dem Melken schon fertig und es musste demnach schon ein ganzes Stück nach sechs Uhr abends sein. Um das zu wissen, brauchtest du keine Armbanduhr, denn bei allen Bauern wurde jeden Morgen und jeden Abend ganz pünktlich um sechs Uhr gemolken, egal, ob es ein normaler Arbeitstag, Sonntag oder ein Ferientag war. Darauf konnten sich die Kühe und auch du verlassen.
Tatsächlich kam Onkel Otto bereits in seinen blauen Arbeitssachen seine Hofeinfahrt herunter und begann die vollen Kannen von seiner Karre zu laden. Auf einmal jedoch hielt er inne und blickte direkt in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein Geräusch gemacht habe oder ob er einfach so eine Ahnung hatte, dass sich dort jemand hinter seiner Hecke versteckt hielt. Jedenfalls entdeckte er mich in dem Weißdorn und fragte grinsend: „Wat sit du doa achter de Heck, Sünje?“ Natürlich fragte er das auf Plattdeutsch und sprach dabei meinen Namen mehr aus wie „Sündsche“. So nannten mich damals alle Nachbarn. Onkel Otto wollte also gerne wissen, was ich da hinter seiner Hecke zu tun hatte.
Selbstverständlich verstand ich seine Frage und ich es hätte es ihm auch wirklich nur zu gern ausführlich erläutert, aber ich hatte nun wirklich keine Zeit mehr für Erklärungen. In dem Moment kam nämlich schon der Milchwagen von der Meierei aus Meldorf um die Ecke gebogen, um die vollen Kannen aus Ammerswurth abzuholen. Schließlich brauchten die Menschen in Meldorf ja auch frische Milch und dort gab es nicht eine einzige Kuh. Das wiederum bedeutete, dass es schon halb sieben war. Ich musste wirklich ganz dringend nach Hause. „Tschüß, Onkel Otto!“, rief ich und rannte los.
Es ging erst einmal schnell aber vorsichtig über die Teerstraße, dann über den schmalen, stinkigen Jaucherinnsal, der aus dem Kuhstall von Onkel Werner und Tante Marga in den Graben floss, dann quer durch den Obstgarten von Onkel Otto und Tante Marianne, über den Knick auf unseren Hof, vorbei an dem alten Pumpsklo, in dem ich die Banditen hatte einsperren wollen, rund um unser Haus bis nach vorne in den Garten. Schon am Plumpsklo hörte ich meine Mutter nach mir rufen: „Sünje! Süüüünje! Abendbrot!“
Ziemlich aus der Puste kam ich an der Haustür an, wo meine Mutter stand und nach mir Ausschau hielt. „Da bist du ja endlich.“, sagte sie als ich sie erreicht hatte, „Wir warten schon mit dem Essen auf dich.“ Zum Glück klang sie nicht böse und Essen klang richtig gut. Ich merkte erst in dem Moment, dass ich wirklich hungrig war. Schließlich hatte ich ja auch seit dem Mittag nichts mehr gegessen, mal abgesehen von dem klebrigen Eukalyptusbonbon. Eine Scheibe von Bäcker Timms leckeren Brot und ein frisches Glas Milch von Onkel Werners Kühen, das war jetzt genau das Richtige!
Ich wandte mich zur Tür, um in Haus zu gehen. „Halt Stopp!“ rief meine Mutter, mich von oben bis unten musternd, „Erstmal Füße waschen!“ Okay, also wie jeden Abend im Sommer, wenn ich den ganzen Tag barfuß herumgelaufen war. Ich ließ mich ins Gras fallen, während meine Mutter im Haus verschwand, um kurz darauf mit einer dampfenden Schüssel Seifenwasser und einem Handtuch wieder herauszukommen. Sie stellte die Schüssel vor mir ins Gras und ich tauchte meine, zugegeben doch ziemlich schmutzigen, Füße in das warme Wasser. Richtig schön viel Schaum war darauf! Schaum mochte ich gern, übrigens auch in der Badewanne, in der ich jeden Sonntagabend baden durfte.
Nach diesem anstrengenden Tag tat es richtig gut, einfach ein noch ein bisschen dazusitzen und den warmen Sommerabend zu genießen. Ich plantschte mit den Füßen in dem herrlich warmen Wasser. Ich konnte mir ruhig ein bisschen Zeit lassen. So schmutzige Füße müssen schließlich erst einmal ordentlich einweichen, bevor du sie überhaupt wieder sauber bekommst. Irgendwo über mir in einem der Bäume gurrte eine Taube. In dem Moment verstand ich meinen Vater zum ersten Mal, der manchmal, wenn er abends nach Hause kam, schwer seufzte und dann sehr müde sagte: „Feierabend.“ Das klang immer ganz zufrieden, obwohl er sehr müde war, und auch ein bisschen erleichtert. Nun hatte ich also auch mal Feierabend. Und ich muss sagen, ich fand das richtig schön, nach Hause zu kommen und Feierabend zu haben!
Aber als ich nochmal so richtig über meinen ersten Arbeitstag als Sheriff nachdachte, merkte ich, dass es mir doch nicht ganz so ging wie meinem Vater. Müde war ich genau wie er und auch ein bisschen erleichtert und hungrig obendrein. Aber zufrieden? Nein, ganz zufrieden war ich irgendwie nicht. Ich hatte von dem Banditen den Sheriffstern bekommen und war so zum Sheriff geworden. Ich hatte ziemlich gute Sheriffsachen zum Anziehen und eine tolle Pistole gefunden, aber trotz aller Mühen und Anstrengungen hatte ich keinen einzigen Banditen fangen können und dann auch noch meine Pistole verloren. Meine Hilfe hatte auch niemand gebraucht. Keiner hatte etwas von nützlichen Dingen in meiner Sherifftasche wissen wollen und niemand hatte sich im Weizenfeld verirrt, um von mir gerettet zu werden.
Wenn ich es nüchtern betrachtete, war das Ganze doch ein ziemlicher Misserfolg geworden. In Ammerswurth gab es einfach zu wenige Banditen und alle Menschen, die hier wohnten, schienen ziemlich gut ohne einen Dorfsheriff zurechtzukommen. Das Gefährlichste weit und breit war die Ponybande und gegen die kam ich auch als Sheriff nicht an, das war klar. Kurz gesagt, wirklich absolut niemand brauchte mich hier als Sheriff! Nein, keine Sorge, bei dieser Erkenntnis fühlte ich mich ausnahmsweise einmal nicht peinlich. Es hatte ja nicht an mir gelegen, ich hatte doch alles versucht. Es war einfach so, dass Ammerswurth nun mal der falsche Ort für diesen Beruf war. Im wilden Westen hätte ich Erfolg gehabt, da war ich mir absolut sicher.
Aber so, wie die Dinge nun einmal lagen, machte es keinen Sinn weiter Sheriff zu bleiben. Du würdest wahrscheinlich ja auch nicht dort Bäcker sein wollen, wo niemand Brot mag oder Süßigkeiten anbieten, wenn nie jemand mit einem Fünfzigpfennigstück zum Tauschen vorbeikommt. Und nur wegen eines Berufes umziehen, wollte ich schließlich auch noch nicht. Also beschloss ich, das Sheriffsein aufzugeben. Ammerswurth hatte nun für einen ganzen, langen Tag einen Sheriff gehabt und niemand, so fürchte ich, hatte es überhaupt gemerkt, wie schwer ich an diesem Tag gearbeitet hatte. Auch wenn es ein bisschen schade war, das musste nun reichen! Bis ich zur Schule kommen würde, würde ich jetzt erst einmal nur Kindergartenkind ohne einen zweiten Beruf bleiben. Damit hast du schließlich schon genug zu tun. Denk zum Beispiel nur ans Liederlernen und einhändig Radfahren Üben. Das ist anstrengend genug.
Eine allerletzte Sache wollte ich jedoch noch als Sheriff erledigen. Im Laufe des Tages hatte ich ja wohl alle Sachen aus meiner Sheriffausrüstung gebraucht, bis auf zwei – den grünen Kamm und den Spiegel mit dem gelben Griff. Das ging so nicht, schließlich wollte ich die ganze Sache doch wenigstens noch zu einem angemessenen, richtigen und kompletten Abschluss bringen. Außerdem kann es ja nicht schaden, sich nach einem ganzen Tag, an dem du draußen in der Sommerhitze herumgerannt und durch Weizenfelder marschiert bist, mal ein bisschen die Haare zu kämmen. Ich wusch mir also schnell meine Hände neben meinen Füßen im Seifenwasser, trocknete sie ab und holte Kamm und Spiegel aus meiner Sherifftasche, die ab morgen wieder nur die ganz normale blaue, stinkige Tasche sein würde.
Ich kämmte meine Haare. Allerdings nur ein bisschen, denn sie waren tatsächlich ziemlich verstrubbelt und das Kämmen ziepte einfach zu sehr. Der gute Wille musste reichen. Dann betrachtete ich mich in dem kleinen Spiegel. Allzu viel konntest du darin nicht erkennen. Zum einen war er eben wirklich klein, so dass dein ganzes Gesicht überhaupt nicht darauf passte, und zum anderen war das Spiegelbild auch nicht so scharf, wie zum Beispiel das von dem Spiegel in unserem Badezimmer. Ein bisschen was konnte ich aber immerhin doch sehen.
Ich war ein Mädchen. Ziemlich braungebrannt mit etwas verstrubbelten dunkelblonden Haaren. Ein bisschen sah ich noch aus wie ein Kindergartenkind, aber wie eins von den großen aus der Spatzengruppe, die bald in die Schule kommen, nicht wie eins von den kleinen aus der Häschengruppe. Ich war sicher, dass ich an diesem langen, anstrengenden Tag als Sheriff ein bisschen älter geworden war und das machte mich sehr zufrieden. Einen richtigen Beruf zu haben, half dir offenbar schneller älter zu werden, wenn er nur anstrengend genug war. Ja tatsächlich, damals habe ich mich darüber noch sehr gefreut, älter zu werden. Heute ist das bei mir irgendwie nicht mehr ganz so wie früher, scheint mir. Nun denn. Jedenfalls steckte ich Kamm und Spiegel zurück in die Tasche – nun war alles erledigt, was ich jetzt an meinem letzten Arbeitstag als Sheriff noch hatte tun können.
Eines nahm ich mir in diesem Moment aber noch ganz fest vor: Für später in meinem Leben wollte ich mir einen Beruf aussuchen, der nicht so anstrengend und schwierig war. Tierärztin vielleicht oder Lehrerin. Ja, Lehrerin war doch eine tolle Idee. Als Lehrerin kannst du jeden Tag Schule spielen und das auch noch in einem echten Klassenzimmer mit einer richtig großen Tafel zum Malen! Und, ob du es glaubst oder nicht, Lehrerin bin ich dann viele, viele Jahre später tatsächlich mal geworden und das nicht nur für einen Tag. Damit war es dann aber auch so eine Sache, ein bisschen so wie mit dem Tag, an dem ich Sheriff war. Ich hatte es mir auch einfacher und irgendwie anders vorgestellt. Auf jeden Fall war es ganz, ganz anders als Schule zu spielen. Aber das ist natürlich schon eine neue Geschichte, die ich dir vielleicht irgendwann auch einmal erzählen kann.
Die Geschichte von dem Tag, an dem ich Sheriff war, endet nun hier im Garten, wo ich mir schließlich die Füße abtrocknete und dann über den kalten Terrazzoboden in die Küche tapste. Alle saßen schon am gedeckten Abendbrottisch und warteten auf mich. „Na, was hast du heute Schönes gemacht?“, fragte meine Mutter. „Och, nichts Besonderes.“, antwortete ich und merkte dabei, dass ich wirklich ganz schön müde war. Ich freute mich schon auf mein gemütliches Bett und die Gute-Nacht-Geschichte, die meine Mutter mir bestimmt vorlesen würde. Vielleicht würde sie mir ja auch noch eines ihrer schönen Lieder vorsingen.
Und morgen, ja, morgen würde ich einfach meinen freien Tag genießen. Nach all den Strapazen endlich mal ein freier Tag, ohne Verpflichtungen, Blamagen, Gefahren und vor allem Langeweile. Ich könnte mir eine Höhle bauen oder versuchen, die Schafe im Apfelgarten zu zähmen oder den ganzen Tag so tun, als ob ich ein Hund wäre oder mit meinem kleinen grünen Fahrrad zu Frau Timm fahren und mit ihr über Süßigkeiten verhandeln. Möglichkeiten über Möglichkeiten, ein ganzer, langer Tag voller Möglichkeiten. Das Leben ist doch zu schön!
Meine Pistole blieb übrigens für immer verschwunden, aber den silbernen Sheriffstern trug ich weiter an meiner Sheriffhose. So lange, bis ich so groß geworden war, dass sie mir nicht mehr passte und Sheriffhose und Sheriffstern irgendwann gemeinsam verschwanden. Ich habe beide nie wiedergesehen. Aber vielleicht hat ja noch ein anderes Kind große Abenteuer damit erlebt. Wer weiß?